Für Ärzt*innen
Hier finden Ärztinnen und Ärzte eine Vielzahl an Informationen und Angeboten, die dabei unterstützen sollen, Prävention, Diagnostik und Therapie von bzw. bei Patient*innen rund um Fragestellungen zum Fettstoffwechsel und zu Atherosklerose sowie Folgeerkrankungen zu verbessern. Es gilt: Je höher das Gesamtrisiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, desto niedriger sollte der LDL-Cholesterinwert und desto intensiver sollten die Maßnahmen sein, um erhöhte Werte zu senken. Ziel muss sein: Die „Cholesterinjahre“ von Patient*innen müssen bestmöglich reduziert werden — also jene Jahre, die Menschen mit einem erhöhten LDL-Cholesterinwert leben. Mehr als 80 Prozent der betroffenen Hochrisiko-Patient*innen in Deutschland werden bis heute nicht ausreichend effektiv therapiert und begleitet.
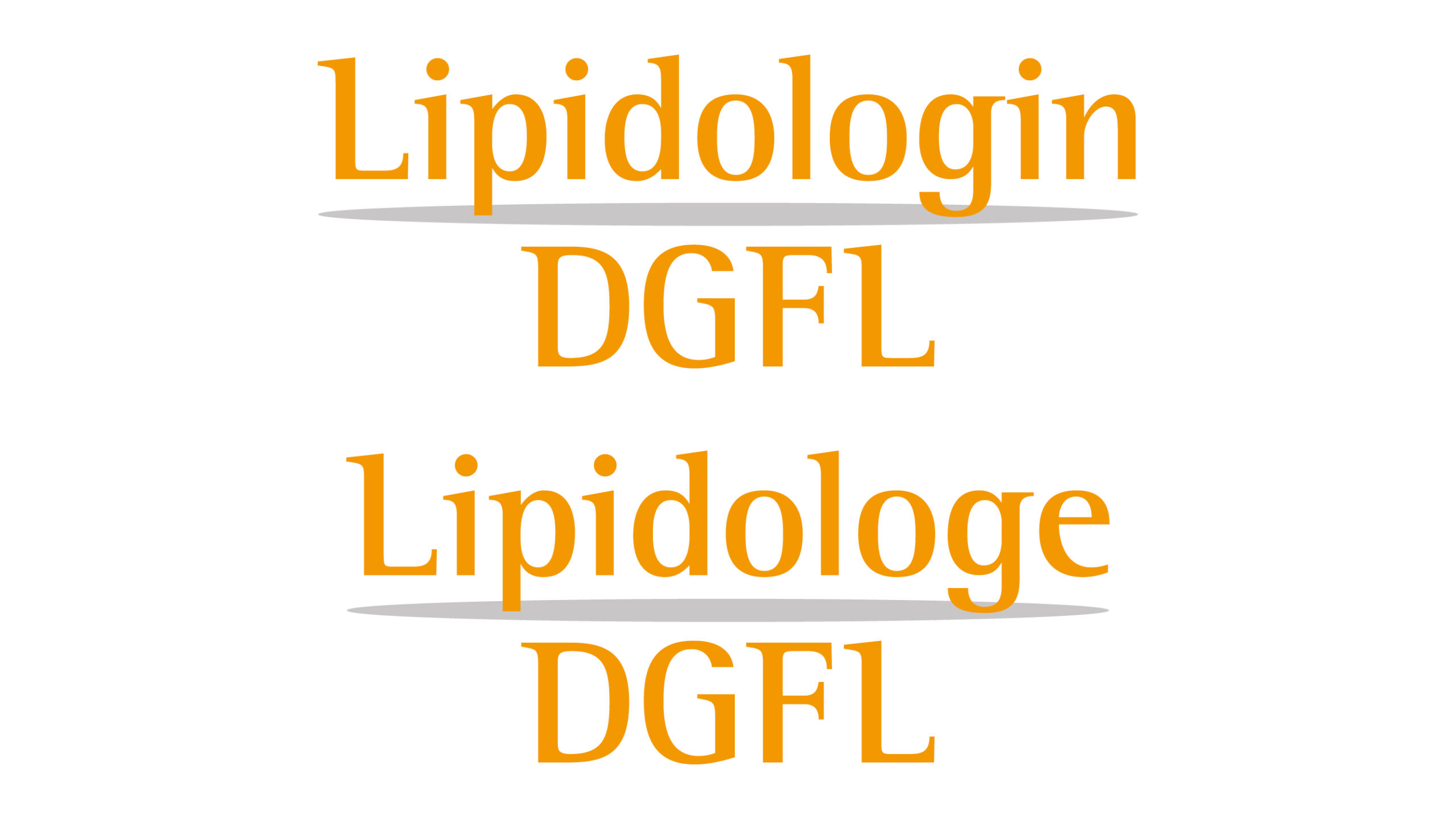
Ärztliche Fortbildungen
und Zertifizierungsprogramm
Die DGFL – Lipid-Liga e. V. bietet sowohl eine strukturierte curriculäre Fortbildung „Lipidologie DGFL“ an als auch darauf aufbauend ein umfassendes Zertifizierungsprogramm für Versorgungsstrukturen zur Förderung der Prävention und der Qualitätssicherung bei Diagnostik und Therapie von Dyslipidämien und ihren Folgen.
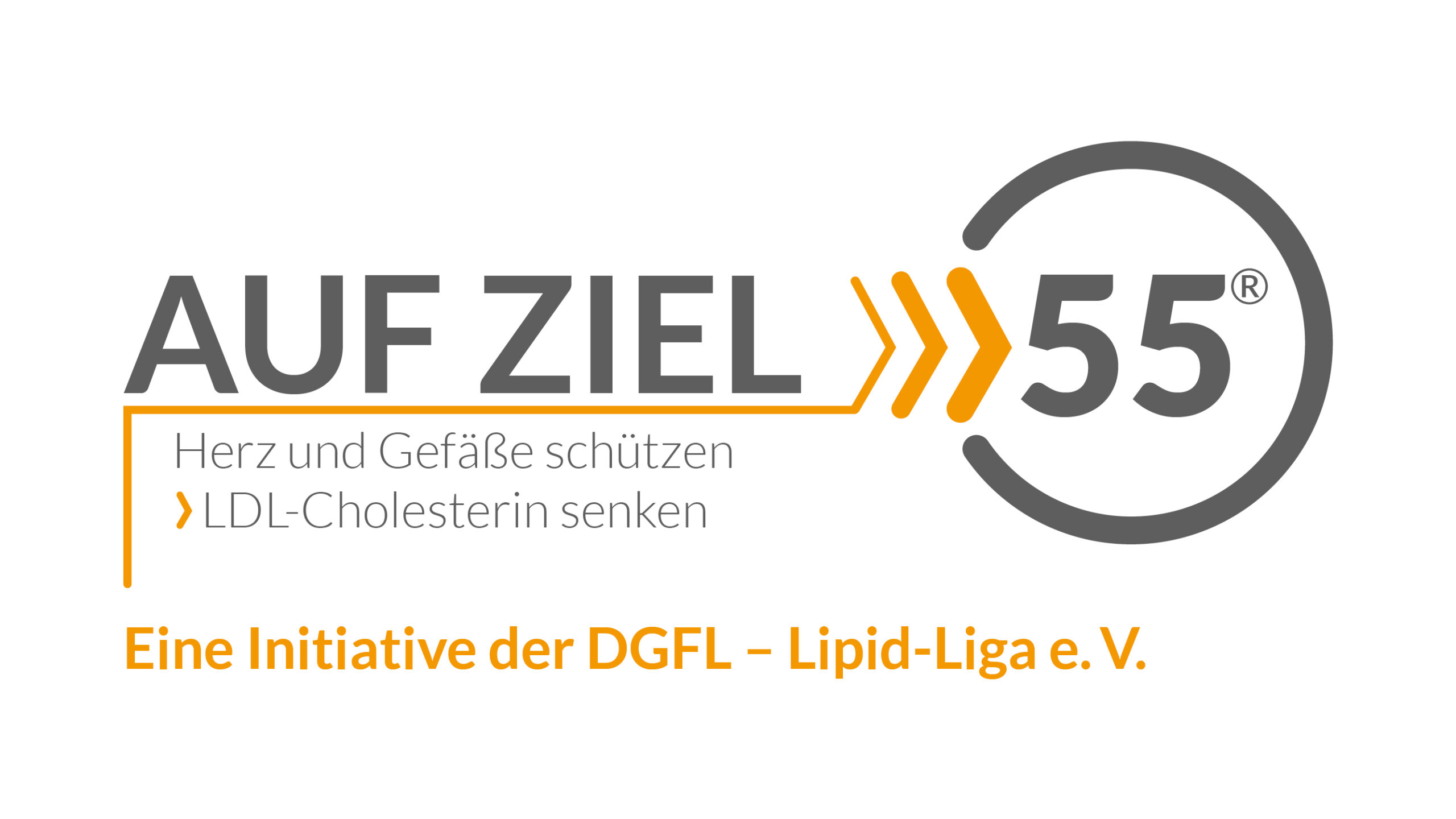
Kampagnen & Aktionstage
Kardiovaskuläre Hochrisikopatient*innen sollten einen LDL-Cholesterin-Zielwert von unter 55 mg/dl erreichen. Doch in Deutschland sind mehr als 80 Prozent der Betroffenen nicht gut eingestellt. Das muss sich ändern. Deshalb startete die DGFL – Lipid-Liga e. V. die bundesweite Initiative „Auf Ziel >>> 55“. Aber auch andere Kampagnen sorgen für notwendige Aufmerksamkeit, z. B. der jährliche „Tag des Cholesterins“.

Veranstaltungen im Überblick
Die DGFL – Lipid-Liga e. V. bietet eine Vielzahl von Fachveranstaltungen wie Symposien und Expertengespräche an, oft auch kongressbegleitend und teilweise in Kooperation mit anderen Fachgesellschaften. Erfahren Sie hier mehr. Alle hier genannten Veranstaltungen werden als Fortbildungen für Lipidolog*innen DGFL – Lipid-Liga e. V. anerkannt.

Apherese-Register
Das Deutsche Lipoproteinapherese-Register (DLAR) ist das weltweit größte und einzige spezifische Lipoproteinapherese-Register mit der längsten Beobachtungszeit. Mit der Aufnahme der Lipoproteinapherese-Therapie bei Lp(a)-Hyperlipoproteinämie in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen wurde es auf Forderung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) eingerichtet.
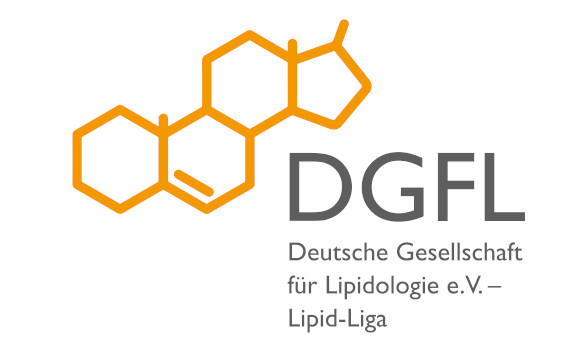
Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie von Fettstoffwechselstörungen
Aktuell liegen nationale und europäische Leitlinien für die Diagnostik und Therapie von Dyslipoproteinämien vor. Deren wesentliche Grundlage ist die therapeutische Evidenz der LDL-Cholesterin (LDL-C)-Senkung. (…) Das Ziel dieser Ausführungen der DGFL – Lipid-Liga e. V. ist, praxisorientierte Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie häufig auftretender Fettstoffwechselstörungen zu geben. Zu bedenken ist immer, dass es viele seltene und sehr seltene Fettstoffwechselstörungen gibt. Mehr hier.
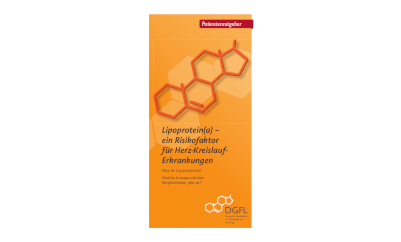
Material für Patient*innen
Jeder sollte zumindest seinen LDL-Cholesterinwert kennen. Ist er dauerhaft zu hoch, kann es zu Ablagerungen in den Blutgefäßen und damit zur Entstehung von Atherosklerose kommen. Diese kann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall begünstigen. Für Patient*innen hat die DGFL – Lipid-Liga e. V. verschiedene Ratgeber und Publikationen aufgelegt, die hier heruntergeladen und/oder bestellt werden können.
Ärztlicher Beratungsdienst & mehr
Hier gibt es Hilfestellungen für die tägliche Arbeit in der Praxis oder Klinik. Vom „Ärztlichen Beratungsdienst `Fettstoffwechselstörungen´“ über klinische Fallbeispiele (Kasuistiken) bis hin zu verschiedenen Berechnungshilfen sowie den jeweils gültigen Leitlinien der relevanten ärztlichen Fachgesellschaften.

News
Hier halten wir für Sie zahlreiche News, Pressemitteilungen und mehr zur stets aktuellen Information bereit.

Stellungnahmen
Sie fragen sich, welche Positionen oder Standpunkte die DGFL – Lipid-Liga e. V. zu verschiedenen Themen wie strittigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, legislativen Prozessen oder Diskursen zur Nutzenbewertung neuer therapeutischer Möglichkeiten vertritt? Hier können Sie die Stellungsnahmen unserer Organisation nachlesen.
